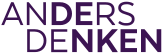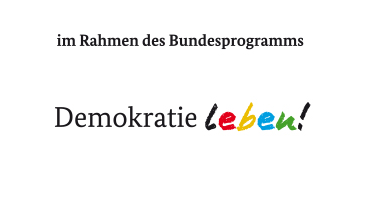Die affektive Dimension des Antisemitismus
Einleitung
Im Frühjahr 2024 wurden vielerorts auf dem Gelände von Universitäten Camps errichtet von Aktivist:innen, die sich mit den Menschen im Gaza-Streifen solidarisieren wollten und auf ihr Leid angesichts der israelischen Militäroperation gegen die Hamas aufmerksam machen wollten. Schnell wurde allerdings klar, dass diese Camps auch dazu dienten, antisemitische Positionen in die Gesellschaft zu tragen. Auf Demonstrationen gegen Israel oder bei Gebäudebesetzungen herrschte meist eine aufgeheizte, aggressive Stimmung. Im Kontrast dazu trafen Besucher:innen der Camps oft auf eine freundliche, gemeinschaftliche Atmosphäre. Lesungen, Bastelworkshops und gemeinsame Abende waren Teil des Campalltags. Wie passt dies zusammen?
I. Relevanz der Affekte
Antisemitismus erscheint keineswegs immer als Hass gegen Jüdinnen und Juden. Im Gegenteil: Der bekundete Affekt ist eher ein “gerechter Zorn gegen Unterdrücker” oder aber die antisemitische Haltung wird als Ergebnis einer nüchternen Analyse der Weltlage ausgegeben. Doch der Philosoph Constantin Brunner wusste schon 1919: „Haß ist Haß und bleibt Haß, ist und bleibt Affekt, ob er sich auch wissenschaftlich maskiert.“[1] Niemand übernimmt eine antisemitische Haltung, weil die Argumente dafür überzeugend sind (das sind sie nicht), sondern weil diese Haltung eine affektive Befriedigung liefert. Die Argumente, die den Hass rechtfertigen, folgen nach. Daher hat politische Bildung, die nur auf Aufklärung setzt, hier einen schweren Stand. Aber das affektive Wesen des Antisemitismus ist nicht nur Hass, es ist auch Gemeinschaft. Antisemit*innen sind subjektiv nie Einzeltäter*innen: Zumindest imaginär sprechen und handeln sie für eine Gemeinschaft, in der Einheit und Harmonie herrsche und die gegen die Zersetzung und Zerstörung durch feindliche Mächte verteidigt werden müsse. Bevor wir die Affekte weiter ausführen, folgt zunächst eine kurze Charakterisierung der Spezifika des Antisemitismus gegenüber anderen Feindbildungen.
II. Antisemitismus und Rassismus
Antisemitismus funktioniert anders als etwa rassistische Vorurteile. Rassismus zielt auf die Abwertung einer als unterlegen wahrgenommenen Gruppe ab. Antisemitismus wendet sich gegen zugleich als unterlegen und überlegen wahrgenommene Jüdinnen und Juden. Er ist umfassender als Rassismus. »Der Jude« des Klischees ist nicht nur lüstern, dreckig und »weibisch«, sondern auch verkopft, patriarchal und Anhänger einer Gesetzesreligion.[2] Rassismus ist eine Legitimationsideologie, Antisemitismus eine Rebellionsideologie. Ersterer Ideologietyp rechtfertigt Herrschaft („Weiße sind intelligenter und deshalb besser für Leitungsfunktionen geeignet.“), letzterer übt scheinbar eine Herrschaftskritik.[3] Dies hat eine lange Tradition: Schon die Antisemit:innen des 19. Jahrhunderts machten Juden als ‘die Mächtigen’ aus, die ‚Hinter den Kulissen‘ die Strippen ziehen würden und für die Leiden der Moderne verantwortlich sein. Im Antisemitismus wird so die Nicht-Einlösung der ideologischen Versprechen moderner Staaten erklärt („Eigentlich müsste diese Gesellschaft doch Freiheit, Recht auf Selbstverwirklichung und steigenden Wohlstand für diejenigen, die sich anstrengen bringen – warum ist das nicht so?“). Wer die Widersprüche von Ökonomie und Politik nicht versteht, muss dem Augenschein nach geradezu annehmen: Da steckt eine böse Absicht dahinter und diese Absicht wird Jüdinnen und Juden zugeschrieben. Rassist:innen verteidigen also die eigene Vorherrschaft, während Antisemit:innen sich als Rebell:innen erleben, als Freiheitskämpfer, die als Teil einer gleichgesinnten Gemeinschaft und geleitet von edlen Führern gegen geheime Unterdrücker und böse Herrscherinnen kämpfen: ‚antikapitalistisch‘ gegen ‚die Banker‘, ‚antisexistisch‘ gegen das ‚isralische pinkwashing‘,[4] ‚antirassistisch‘ gegen den ‘zionistischen Apartheidstaat’ - und in letzter Konsequenz, den historisch ausgetretenen Assoziationspfaden der Diskurse folgend, immer gegen »die Juden«. Doch kaum eine:r will heutzutage antisemitisch sein. Strukturell antisemitische Argumentationsmuster bedienen sich daher Ersatzgebilden, Chiffren von ‘globalen Eliten’ über ‘die Rothschilds’ bis hin zu ‘den Zionisten’.
III. Projektion und Massenpsychologie
Auf der affektiven Ebene sind für diese antisemitische Haltung der Hass und das Gemeinschaftsgefühl zentral. Untersuchungen zur Geschichte dieser Affekte und Erklärungen, wie sie zur Grundlage einer antisemitischen Haltung werden, finden sich unter anderem in der Psychoanalyse. Diese ist nicht nur eine Therapieform, sondern auch eine Affekt- und Sozialpsychologie, die den Antisemitismus seit ihren Anfängen untersucht. Zwei Begriffe sind dabei zentral: Projektion und Massenpsychologie. Ernst Simmel hat den Antisemitismus als “Wahn” beschrieben, d.h. eine Verzerrung der Wahrnehmung, die über “Projektion” funktioniert. Projektion bedeutet, dass angstmachende „innere Objekte“ wie scham- und schuldbehaftete Konflikte nach außen verlagert werden. Dort erscheinen sie dann nicht als Eigenschaft des Selbst, sondern als Monster oder strafende Stimmen, die das Subjekt verfolgen. Laut Simmel sind die antisemitischen Vorstellungen übermächtiger Agenten der jüdischen Weltverschwörung, die die Medien und die Wirtschaft lenken, ähnlichen psychischen Ursprungs (vgl. Simmel 1946). Aber: Auch wenn der Antisemitismus damit wie ein Wahn, das heißt wie ine Psychose funktioniert, sind Antisemit:innen nicht psychisch krank. Sie sind ‚normal‘ und agieren realitätsgerecht – bis man auf das Judentum oder Israel zu sprechen kommt (vgl. Pohl 2010).
Und anders als eine Psychose ist der Antisemitismus kein individuelles Phänomen. Antisemit:innen gibt es nie einzeln, sondern nur als (imaginäres) Kollektiv. Hier kommt der Aspekt der Massenpsychologie zum Tragen: Dieses Konzept Sigmund Freuds beschreibt die affektiven Bindungen in Gemeinschaften, die nicht über individuelle Beziehungen, sondern über die von ihren Mitgliedern geteilte, idealisierende Liebe zu einem Dritten – dem Führer, der Fahne, der ‚Sache‘ – gestiftet werden. In solchen Gemeinschaften können Gefühle der Einheit und der Größe genossen werden. Allerdings basiert dieser Genuss auf Abwehr aller Ambivalenzen und (Macht-)Konflikte, die in Gruppen unvermeidlich auftreten. Nur wenn diese die Einheit zersetzenden Dynamiken nach außen projiziert werden, kann an dem Erleben der störungsfreien Eigengruppe festgehalten werden.
Im Kontext der historischen Entstehung europäischer Nationen als rechtliche, aber auch gefühlte Gemeinschaften werden Jüdinnen und Juden zu Feinden der Völker erklärt. In dieser Funktion habe „‚das überallhin versprengte Volk der Juden’ sich – wie Freud bitter-sarkastisch schreibt – ‚anerkennenswerte Verdienste um die Kulturen seiner Wirtsvölker erworben’”.[5] Psychoanalytisch gesprochen enthalten rassistische Projektionen in erster Linie „Es”-Anteile, individuelle leibliche Lüste, die mit der Imagination einer harmonischen Gemeinschaft unverträglich sind (vgl. bspw. das Klischee von ‘schwarzen Vergewaltiger’). Antisemitische Projektionen enthalten zudem auch „Ich”- und „Über-Ich”-Anteile, d.h. störende Elemente von Gewissen und Individualität (vgl. bspw. die Klischees vom jüdischen ‚spaltenden Kritiker’ oder dem ‚Hohepriester des Schuldkults’) (vgl. Rommelspacher 2005, S. 14f.; Winter 2023, S. 120).
Kurzum: Zu sagen, man habe Angst vor der Übermacht ‘der Rothschilds und George Soros’ oder man sei ein ‚Freiheitskämpfer gegen die Unterdrücker der freien Völker‘ ist in Wahrheit kein Ausdruck von Rebellion oder Angst, sondern von Konflikt- und Angstabwehr. Darin, dass wahre Affekte wie zwischenmenschliche Ambivalenzen, Ängste, Wut auf Lebensumstände und die Unbehaglichkeit in der modernen Welt in den Hass auf Jüdinnen und Juden oder Platzhalter kanalisiert werden, liegt das perfide des Antisemitismus. Er vermittelt ein Gefühl des Widerstands und verunmöglicht zugleich Kritik oder Aufbegehren.
Antisemitismus besteht also aus drei Schritten:
- Menschen genießen ein Gemeinschaftsgefühl, bei dem Gefühle von Einheit und Überlegenheit geweckt werden.
- Daraus entsteht projektiver Hass, der sich als Gewalt äußern kann.
- Im Nachhinein werden diese Haltung und dieses Verhalten als notwendig, politisch oder moralisch gerecht dargestellt.
IV. Beispiel: Israelbezogener Antisemitismus
Die hinter den ideologischen Rechtfertigungen verdeckten affektiven Dimensionen brechen derzeit besonders bei dem sogenannten israelbezogenen Antisemitismus aus. Das offensichtliche Leid palästinensischer Zivilist:innen während Israels Militäroperation gegen die Hamas bietet einen Hintergrund, der besonders geeignet ist, affektive Reaktionen auszulösen und aufrechtzuerhalten. Dabei ist das Entsetzen über dieses Leid nicht zu kritisieren; es ist selbstverständlich nicht antisemitisch. Die Frage ist, was aus diesem Entsetzen folgt. Es kann dabei abgewehrt und über ein vermeintlich solidarisches Gemeinschaftsgefühl mit einem palästinensischen ‚Widerstand‘ und über Hass gegen Israel verarbeitet und ersetzt werden. Dabei wird Israel allein schuld am Leiden palästinensischer Zivilist:innen zugewiesen und eine bösartige Absicht unterstellt: Es gehe gar nicht um Verteidigung oder das Bekämpfen der Terrororganisation Hamas, sondern darum einen Völkermord an ihnen zu verüben. Dabei werden Fakten wie die Nutzung der Bevölkerung Gazas als menschliche Schutzschilde geleugnet und auf antisemitische Stereotype (z.B. Vernichtungswille, Bösartigkeit, Übermacht) zurückgegriffen. In dieser Weltsicht ist Israel, als “Jude unter den Völkern”, Schuld am Leiden der Welt. Massaker an Jüdinnen und Juden werden zu einem gerechten Unterfangen umgedeutet. Dabei zeigt sich überdeutlich die gemeinschaftsstiftende, integrierende Funktion des Antisemitismus als Brückenideologie: Feministinnen und Antifeministen, Antirassist:innen und Rassist:innen, progressive Studierende und Islamisten tun sich gegen einen gemeinsamen Feind zusammen.
In den Camps auf den Universitätsgeländen wird eine Gemeinschaft genossen, deren Akteur:innen sich selbst als bedrohte Verteidiger der Menschheit gegen die Herrschaft erleben. Die wütende Abwehr von Antisemitismusvorwürfen, die Empathielosigkeit gegenüber den jüdischen und nicht-jüdischen Opfern der Hamas und die Abwesenheit von (Selbst-)Kritik zeigen die Doppelbödigkeit: Hinter der ‚Solidarität‘ und dem ‚Kampf‘ liegen Massenpsychologie und Projektion. Sie dienen der ängstlichen Abwehr der Konflikte, des Entsetzens und der Ängste, die echte Solidarität mit sich brächte.
V. Fazit und Ausblick
Antisemitische Haltungen sind nicht nur Ergebnis eines falschen Denkens, sondern einer Affektdynamik, bei der Unangenehmes abgewehrt und als affektiver Rohstoff stattdessen in Gemeinschaftsgefühle und Hass genossen wird. Antisemitismus hat daher immer zwei Ebenen: Die Ebene der bekundeten Gefühle und die Ebene der abgewehrten unterliegenden Affekte. Die Virulenz der abgewehrten unterliegenden Affekte nimmt aktuell in Zeiten der Polykrise zu, wenn Angst durch die Unvorhersehbarkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen entbunden wird. Diese Ängste zu artikulieren und im Sinne einer Mündigkeit zu bearbeiten, sollte Ziel antisemitismuspräventiver politischer Bildung und Demokratieförderung sein.
Literatur
Brunner, Constantin (1919), Der Judenhass und die Juden. Berlin.
Pohl, Rolf (2010), Der antisemitische Wahn. Aktuelle Ansätze zur Psychoanalyse einer sozialen Pathologie, in: Wolfram Stender/Guido Follert/Mihri Özdogan (Hg.), Konstellationen des Antisemitismus. Antisemitismusforschung und sozialpädagogische Praxis, Wiesbaden, S. 41-68.
Rommelspacher, Birgit (2005): Was ist eigentlich Rassismus? In: Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) (Hg.): Tagungsdokumentation: „Rassismus - eine Jugendsünde?“ Aktuelle antirassistische und interkulturelle Perspektiven der Jugendarbeit, 25./26.11.2005, Bonn, S. 13-21. https://www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/download/Wetzel_Tagungsdo... (14.12.2024).
Simmel, Ernst (1946 [2002]), Antisemitismus und Massen-Psychopathologie, in: Ernst Simmel (Hg.), Antisemitismus. Frankfurt a.M., S. 58-100.
Winter, Sebastian (2013), Geschlechter- und Sexualitätsentwürfe in der SS-Zeitung Das Schwarze Korps. Eine psychoanalytisch-sozialpsychologische Studie, Gießen.
Winter, Sebastian (2017), (Un-)Ausgesprochen: Antisemitische Artikulationen in der Alltagskommunikation, in: Meron Mendel/Astrid Messerschmidt (Hg.), Fragiler Konsens: Antisemitismuskritische Bildung in der Migrationsgesellschaft. Frankfurt a.M., S. 27-42.
Winter, Sebastian (2023): Antirassistischer Antisemitismus & anti-antisemitischer Rassismus? Eine intersektionale Betrachtung jenseits der Soziologie. In: Richter, Salome u.a. (Hg.), Antisemitismus in der postnazistischen Migrationsgesellschaft. Eine interdisziplinäre Bestandsaufnahme, Opladen, S. 111-128.
[1] Brunner 1919, S. 98.
[2] Vgl. Winter 2013: 325ff.
[3] Vgl. Winter 2023.
[4] Das heißt die Vorstellung, Israel präsentiere sich der Weltöffentlichkeit heuchlerisch als queerfreundliche Gesellschaft, sei tatsächlich aber zutiefst patriarchal strukturiert.
[5] Freud 1930, zit. nach Winter 2017, S. 34.
Bildnachweis: Koshu Kunii / unsplash.com