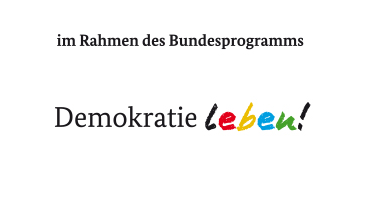Debatte
Meldepflicht antisemitischer Vorfälle an Schulen – Eine kurze Einschätzung zu Grenzen und Chancen
Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird „Antisemitismus“ als eigene Kategorie in die Notfallpläne der Berliner Schulen aufgenommen. Schulen werden damit verpflichtet, neben wie bisher „verfassungsfeindlichen Äußerungen“ künftig explizit auch antisemitische Vorfälle an die Schulaufsicht zu melden. Dort sollen die Fälle künftig zentral dokumentiert werden.1 Antisemitismus an Schulen soll dadurch besser sichtbar und bearbeitbar werden. Ergänzend sollen die betroffenen Schüler/innen und Eltern verstärkt auf die zivilgesellschaftlichen Meldemöglichkeiten hingewiesen werden, um die Meldung eines antisemitischen Erlebnisses von der Meldebereitschaft der Lehrkräfte unabhängig zu gestalten.
Sichtbarmachung: Zur Wichtigkeit antisemitische Vorfälle zu melden
Voraussetzung für eine Erfassung ist die Fähigkeit zum sicheren Erkennen und Einordnen antisemitischer Äußerungen. Ein erster Schritt wäre es, im Bildungsbereich die Arbeitsdefinition Antisemitismus2 als gemeinsamen verbindlichen Deutungsrahmen anzuwenden. Diese Definition schließt mit dem israelbezogenen Antisemitismus u.a. eine Erscheinungsform ein, die zwar besonders weit verbreitet ist, deren Identifizierung jedoch vielfach Probleme bereitet. Dies zeigt etwa ein Vorfall an einer Grundschule in Berlin-Friedrichshain aus dem Juli 2017. Eine jüdische Erstklässlerin erzählte in einem Referat im Fach Lebenskunde von einer Reise nach Israel, die sie zusammen mit ihrem Vater unternommen hatte. Nach ihrem Vortrag bedankte sich die Lehrerin, erklärte aber, dass es wichtig wäre, den anderen Kindern auch zu sagen, dass „die Juden“ (sic) „den Palästinensern ihr Land weggenommen“ haben. Dies blieb ihr einziger Kommentar; zum Aufbau und zur Durchführung des Referats gab sie kein Feedback. Die Lehrerin machte mit ihrer tendenziösen Formulierung vor einer Klasse von ca. 30 Schülern/innen pauschal Jüdinnen und Juden, und somit auch die siebenjährige Schülerin, für Handlungen des Staates Israel verantwortlich.
Meldungen von antisemitischen Vorfällen erfüllen drei grundlegende Funktionen, die auch besonders für den schulischen Kontext gelten.
Erstens ist die Meldung für Betroffene ein wichtiger – und in vielen Fällen auch der einzige – Weg, Hilfe für den persönlichen Umgang mit dem Vorfall zu erhalten. Schulkinder haben einen noch höheren Bedarf nach psychosozialer Unterstützung als Erwachsene, da sie sich noch in der Entwicklung befinden und daher häufiger Schwierigkeiten haben, Anfeindungen der eigenen jüdischen Identität einzuordnen und zu verarbeiten.
Zweitens muss an Schulen, genau wie auch in anderen sozialen Kontext, von einer hohen „Dunkelziffer“ nicht dokumentierter antisemitischer Vorfälle ausgegangen werden. Da sie die Öffentlichkeit nicht erreichen, können sie auch nicht zur Bildung eines Problembewusstseins beitragen. Ausmaß und Allgegenwärtigkeit des Antisemitismus können erst durch eine genaue Erfassung alltäglicher antisemitischer Anfeindungen sichtbar gemacht werden. Allerdings neigen betroffene Schulkinder dazu, die eigenen Erfahrungen gerade nicht zu äußern oder zu melden, etwa aus Angst vor weiteren Anfeindungen oder weil sie die Schuld für die Anfeindung bei sich selbst suchen. Mitunter ist es in Fällen wie dem oben genannten zudem eine Lehrkraft, von der antisemitisches Verhalten oder eine verletzende Äußerung ausgeht, und das hierarchische Verhältnis gibt der Lehrkraft Raum, Handlungsmöglichkeiten des Schülers/der Schülerin einzuschränken. In einigen RIAS Berlin bekannten Fällen gab es in solchen Konstellationen für betroffene Schüler/innen keine andere Möglichkeit mehr als den Schulwechsel.
Und drittens kann erst auf eine Meldung hin eine an den Bedürfnissen der Betroffenen orientierte weiterführende Aufarbeitung durch schulinterne bzw. staatliche Stellen, Erziehungsberechtigte oder zivilgesellschaftliche Träger erfolgen.
Indes konnten in den vergangen Jahren Verhaltensweisen von Lehrern/innen und von Schulleitungen beobachtet werden, die für den Erfolg einer solchen Aufarbeitung hinderlich waren. Das betraf z.B. Situationen, in denen Lehrer/innen, die Schulleitung oder sonstige Verantwortliche den antisemitischen Charakter eines Vorfalls entweder gar nicht erst erkannten oder diesen schlicht in Frage stellten. So sprach im oben zitierten Beispiel der Vater die Schulleitung auf das Verhalten der Lehrerin an, woraufhin er auf den Verband verwiesen wurde, der die Lehrkräfte für den Lebenskundeunterricht stellt. Als der Vater dann diesen Verband kontaktierte und den Fall schilderte, bekam er von einem regionalen Verantwortlichen zu hören, dass man nicht verstehe, worin das Problem liege, schließlich entspreche die Aussage der Lehrerin der Realität.
In manchen Situationen bedurfte es externen, mitunter sogar öffentlichen Drucks, um Verantwortliche der Schule zum Handeln zu bewegen. So wurde Anfang Juni 2018 die Leitung einer Sekundarschule im Bezirk Steglitz-Zehlendorf über einen Schüler informiert, der über mehrere Monate antisemitisch gemobbt wurde. Unter anderem wurden ihm Zettel mit Hakenkreuzen untergeschoben und im Flur zugerufen: „Ab nach Auschwitz in einem Güterzug“. Des Weiteren wurde ihm Qualm einer E-Zigarette ins Gesicht geblasen mit dem Kommentar, dies solle ihn an seine in der Schoa ermordeten Verwandten erinnern. Nachdem die Schule informiert wurde, verging jedoch einige Zeit ohne Reaktion der Leitung. Erst nachdem die Vorfallserie durch die Presse veröffentlicht wurde, drei Wochen nach der ersten Benachrichtigung der Schule, wurden von ihrer Leitung Schritte angekündigt.3
Handeln: Anforderungen an Lehrkräfte im Umgang mit Antisemitismus
Die Fähigkeit zum Identifizieren und Deuten der unterschiedlichen Erscheinungsformen des Antisemitismus im schulischen Kontext ist Voraussetzung, dass die pädagogischen Fachkräfte den Auftrag, der mit der Meldepflicht an sie gestellten ist, überhaupt erfüllen können. Antisemitismus müsste in seiner Spezifik angemessen wahrgenommen werden können. Dieser Anspruch macht die Anforderungen deutlich, die an die im Berliner Landeskonzept verankerten Angebote zur Stärkung der Analyse- und Handlungskompetenz von Lehr- und Fachkräften zu stellen sind.4 In regelmäßigen Fortbildungen sollten die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Antisemitismus vermittelt werden, etwa des völkischen, des post-schoa, des religiös begründeten oder des israelbezogenen Antisemitismus, des Weiteren Kenntnissen über ihr Verhältnis zu anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit wie z.B. Rassismus. Ziel sollte es dabei sein zu vermitteln, dass es sich bei Antisemitismus nicht um ein Phänomen nur der Vergangenheit handelt. Vielmehr ist es zentral, Antisemitismus als eine Herausforderung für pädagogisches Handeln herauszuarbeiten, die bereits weit unterhalb der Schwelle zu physischer Gewalt beginnt. Lehrkräfte haben berichtet, dass sie, um solche Vorfälle im Schulalltag besser einschätzen zu können, zeitliche und räumliche Ressourcen für einen kollegialen Austausch brauchen. Erst auf Basis fundierter und gemeinsam geteilter Einschätzung ist abgestimmtes und angemessenes Handeln möglich. Eine Meldepflicht von Vorfällen kann die gesetzliche Verantwortung der Lehrkräfte zur pädagogischen Intervention nur unterstreichen, sie brauchen aber auch Unterstützung für eine erfolgreiche Umsetzung.
Zudem ist ein Umgang erforderlich, der über die bloße Meldung hinausgeht. Wie könnte ein solcher Umgang aussehen? Zunächst müsste bei der Ausgestaltung der Meldepflicht ein Rahmen gewahrt bleiben, der eine schüler/innengerechte pädagogische Bearbeitung ermöglicht. Das hieße vor allem, dass die Sanktionierung durch Erziehungsmaßnahmen oder gar eine Strafanzeige nur der letzte Schritt einer Reaktionsabfolge sein können. Vorrangig ist, dass in der konkreten Situation antisemitische Aussagen und Verhaltensweisen nicht unwidersprochen bleiben. Handlungsleitend muss dabei stets der Schutz Anwesender und vor allem potentiell Betroffener sein. Es empfiehlt sich, die Äußerungen angemessen als Grenzüberschreitungen klarzustellen und zurückzuweisen, ohne dabei das Ziel des Unterrichts aus den Augen zu verlieren. Häufig ist es sinnvoll, Vorfälle im Nachgang noch einmal aufzugreifen. Das bietet die Möglichkeit, sich fachlich und pädagogisch vorzubereiten, evtl. unter Hinzuziehung von Kollegen/innen, externen Experten/innen oder geeigneten Akteure/innen aus dem Sozialraum. Bei der Suche nach einer angemessenen Form der Intervention können folgende Faktoren eine Orientierung bieten: Wurden die Äußerungen spontan getätigt, oder ist eine strategische Absicht erkennbar? Gibt es Anhaltspunkte für verfestigte antisemitische Einstellungen? Sind Verbindungen des Schülers oder der Schülerin zu politischen Strömungen oder Gruppierungen bekannt, bei denen Antisemitismus zur ideologischen Programmatik gehört? Für den Fall, dass sich Schüler/innen pädagogischen Intervention gegenüber unzugänglich zeigen, sind Sanktionen angezeigt. Sie können zum einen den Schutz von unmittelbar Betroffenen gewährleisten und zum anderen dazu dienen, den Raum für weitere antisemitische Handlungen einzuschränken.5 Bei der Meldung an die Schulaufsicht oder auch eine Einbeziehung von Polizei und Öffentlichkeit, gilt es stets mit Rücksicht auf die Ziele eines schüler/innenorientierten pädagogischen Handelns vorzugehen.
Die Schule steht als Institution in der Verantwortung, und mit ihr die pädagogischen Fachkräfte, alle Formen des Antisemitismus zu unterbinden und zugleich eine antisemitismuskritische Haltung zu stärken. Die Aufgabe von Politik und Verwaltungshandeln ist dabei, einen abgesicherten Handlungsrahmen für die Bearbeitung zu schaffen und Strukturen und Instrumente bereitzustellen, die Schulen und Lehrkräfte in die Lage versetzen, adäquat handeln zu können. Dazu zählt die Verankerung des Themas Antisemitismus in allen Teilen der Lehrer/innenausbildung, beginnend mit dem Studium an den Hochschulen. Verpflichtende Meldeverfahren sind dazu geeignet, antisemitische Vorfälle an Schulen ansprechbar zu machen, und sie können dazu beitragen, Reaktionen zu forcieren und Handlungshemmnisse aufzulösen. Doch aus einer Meldepflicht und aus dem Bedarf nach einer statistischen Erfassung, so begründet sie auch sind, sollten keine zusätzlichen Hindernisse für einen handlungsorientierten Umgang mit Antisemitismus an Berliner Schulen entstehen. Vielmehr sollte eine Regelung gefunden werden, die es Schulen erleichtert, Prävention und Intervention bei antisemitischen Vorfällen zu ihrem eigenen fachlichen Anliegen zu machen. Dafür bedarf die Meldepflicht mindestens der Flankierung durch professionelle Unterstützungseinrichtungen. Betroffene benötigen beispielsweise unabhängige Stellen, falls sie selbst Öffentlichkeit für einen Vorfall herstellen wollen. Auch weitergehende zivilgesellschaftliche Beratungsangebote müssen sowohl für Betroffene als auch – ohne dass sie einen Ansehensverlust fürchten müssen – für Schulen und Lehrkräfte offenstehen.
Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR Berlin) bietet all diejenige Beratung an, die sich z.B. im schulischen Kontext engagieren möchten oder sich aus ihrer professionellen Rolle heraus mit Antisemitismus auseinandersetzen müssen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Gegebenheiten entwickelt die MBR gemeinsam mit den Akteuren/innen vor Ort berlinweit situationsbezogene Handlungsstrategien, informiert und begleitet die Umsetzung. Seit mehreren Jahren qualifiziert die MBR in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern/innen regelmäßig Lehramtsanwärter/innen im Umgang mit Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS Berlin) ist eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle. RIAS Berlin ist parteilich und orientiert sich an den Bedürfnissen und Wahrnehmungen der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder der Zeugen/innen eines Vorfalls. In enger Abstimmung mit der Antidiskriminierungsbeauftragten der Berliner Senatsschulverwaltung wird die von RIAS Berlin bereitgestellte zivilgesellschaftliche Meldemöglichkeit unter www.report-antisemitism.de auch in den Schulen beworben. RIAS Berlin erfasst auch Vorfälle, die nicht angezeigt wurden oder keinen Straftatbestand erfüllen, veröffentlicht diese auf Wunsch der Betroffenen und vermittelt kompetente psychosoziale und juristische Beratungsangebote sowie Antidiskriminierungs-, Opfer- und Prozessberatung.
Anmerkungen
1 Vgl. Jérôme Lombard: Meldepflicht für antisemitische Vorfälle. In: Jüdische Allgemeine vom 15.10.2018. Online
2 Die von auch der Bundesregierung zur Kenntnis genommene Arbeitsdefinition Antisemitismus wurde von mehreren Akteuren der Berliner Zivilgesellschaft für den deutschen Kontext leicht angepasst. Siehe dazu den Eintrag „Antisemitismus“ im Glossar der Berliner Register zur Erfassung rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle. Online
3 Gudrun Mallwitz/Isabell Jürgens/Katrin Lange: Nach Mobbing: Schule will Vorfall umfassend aufklären. In: Berliner Morgenpost vom 28.06.2018. Online
4 Vgl. Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Hg.): Berlin gegen jeden Antisemitismus. Berliner Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismus-Prävention (März 2019), S. 13. PDF
5 Vgl. Samuel Salzborn/Alexandra Kurth: Antisemitismus in der Schule. Erkenntnisstand und Handlungsperspektiven. Berlin 2019, S. 8. PDF
Bildnachweis: Shane Rounce / unsplash.com