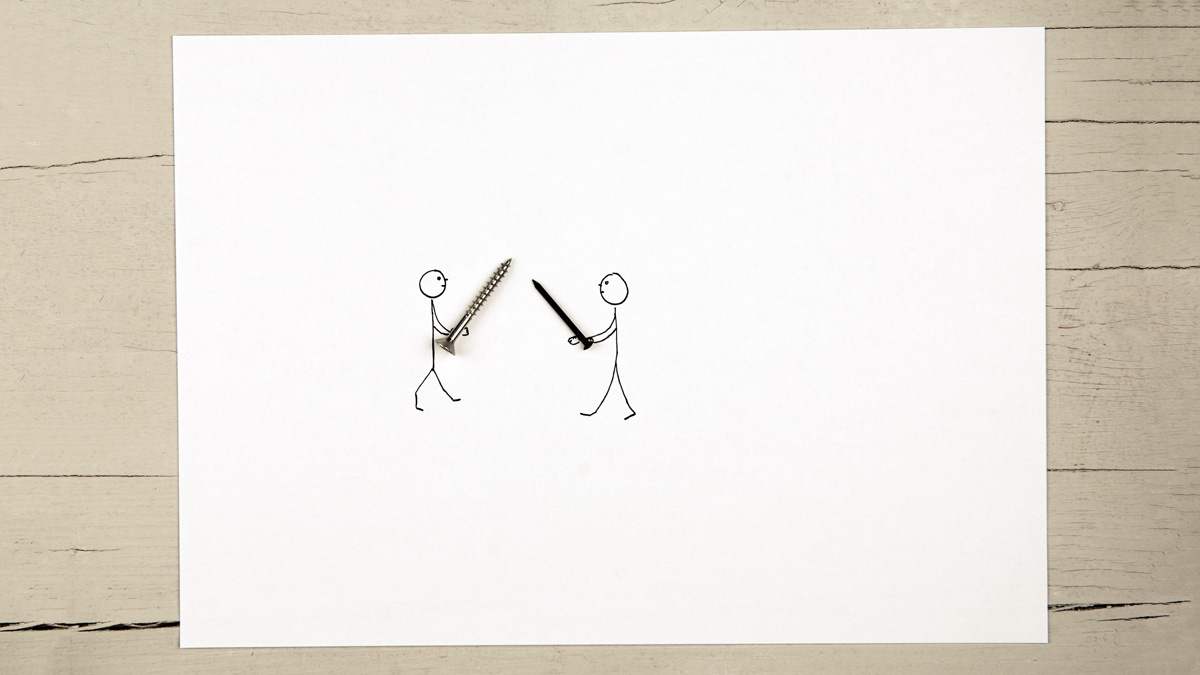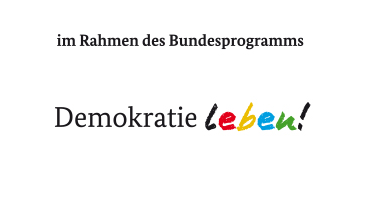Institutioneller Antisemitismus?
Seitdem am 7. Oktober 2023 die Hamas einen brutalen Terroranschlag auf Zivilist:innen in Israel verübte und Israel in der Folge einen Krieg im Gazastreifen begann, ist Antisemitismus abermals ein viel und kontrovers diskutierter Gegenstand. Auffällig ist in der Debatte, wie sehr dabei vor allem individuelle (Straf)Taten und Einstellungen fokussiert werden. Dafür gibt es politische wie wissenschaftliche Gründe. Politisch ermöglicht diese individualisierende Sichtweise, antisemitische Einstellungen und Handlungen als persönliches Fehlverhalten Einiger zu verstehen – derzeit werden, entsprechend eines rassistischen Diskurses, vor allem muslimische Migrant:innen eines solchen „Fehlverhaltens“ verdächtigt. Wissenschaftlich hat die Forschung in Deutschland Antisemitismus lange Zeit vor allem als Ideologie und Weltanschauung verstanden und untersucht. Außer Acht gelassen wurde dabei zu oft, dass aktueller Antisemitismus auch in seiner alltagsbezogenen Dimension und damit auch als systematische Diskriminierung von Jüdinnen und Juden verstanden werden muss.
Bei der Frage, wie sich die gesellschaftliche Alltagsdimension von Antisemitismus stärker in die Analyse einbeziehen ließe, ist ein Blick auf die Rassismusforschung hilfreich, denn auch in der deutschsprachigen Forschung wurde Rassismus lange Zeit primär als eine individuelle „Fremdenfeindlichkeit“ untersucht. In den USA und Großbritannien ist die Debatte deutlich weiter, dort wird bereits seit Jahrzehnten akademisch wie aktivistisch die Frage danach gestellt, wie sich Rassismus gesellschaftlich reproduziert und wie er wirkt Eine wichtige Antwort auf diese Frage liefert das Konzept des „institutionellen Rassismus“. Wir plädieren dafür, Überlegungen aus der Auseinandersetzung mit institutionellem Rassismus auf die Forschung zu Antisemitismus zu übertragen und der Frage nachzugehen, welchen Beitrag Institutionen dafür leisten, das gesellschaftliche Verhältnis des Antisemitismus abzusichern und zu reproduzieren.
Forschungen zum institutionellen Rassismus fragen in der Regel danach, wie rassistische Ausschlüsse in Institutionen und Organisationen so eingeschrieben sind, dass sie nicht mehr auf das Agieren individuell rassistisch eingestellter Personen zurückgeführt werden können. Es geht also nicht um einzelne Angestellte, Lehrer:innen oder Polizist:innen mit rassistischen Haltungen. Vielmehr kommen organisationsspezifische Verfahrensweisen, Normen und Werte in den Blick, aber auch Gesetze, die für eine Organisation gelten oder Wissensbestände in einer Institution, die wertende Wir-Sie Unterscheidungen vornehmen und zu rassistischen Ausgrenzungen führen. Diese können explizit und direkt formuliert sein, wenn beispielsweise das Bundeskriminalamt organisierte Kriminalität als „Clankriminalität“ bezeichnet und verfolgt, wenn sie von muslimisch gelesenen Menschen begangen wird. Aber auch indirektere Formen existieren, wenn etwa das Verbot des Tragens religiöser Symbole für Lehrkräfte de facto nur kopftuchtragende Lehrerinnen vom Schuldienst ausschließt.
Analog dazu ließe sich fragen: Wurde und wird auch Antisemitismus in Form von Werten, Normen und Handlungserwartungen in Institutionen und Organisationen institutionalisiert? Und wenn ja, wo und wie geschieht dies genau? Um darauf eine Antwort zu finden, ist Antisemitismus als eine spezifische gesellschaftliche Praxis, die konkrete diskriminierende Auswirkungen auf Jüdinnen und Juden im Alltag hat, zu begreifen.[1]
Es gibt bisher nur wenige Forschungen, die mit einer solchen Perspektive Antisemitismus untersuchen. Für die Zeit des Nationalsozialismus ist die tiefe Verankerung von Antisemitismus in Institutionen offensichtlich. Aber auch nach 1945 belegen zahlreiche Studien personelle Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus in staatlichen Institutionen, und sie geben Hinweise auf habituelle und ideologische Fortführungen antisemitischer Traditionen. Studien aus den 1990er Jahren zum behördlichen Umgang mit den jüdischen „Kontingentflüchtlingen“ deuten auf eine Ungleichbehandlung in Versorgung, Unterbringung und rechtlicher Anerkennung u.a. bei den Rentenzeiten im Vergleich zu den deutschen Spätaussiedler:innen aus Russland und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion hin. Diese „Benachteiligung von Juden, die ohne antisemitische Benachteiligungsabsichten auskommt“[2] könnte man im Effekt als antisemitisch bezeichnen. Die daraus resultierenden sozioökonomischen Nachteile sind teilweise bis heute sichtbar.
Aktuell verweisen quantitative sozialpsychologisch orientierte Erhebungen zu Diskriminierungserfahrungen jüdischer Menschen auf den Arbeitsplatz und die Schule als institutionelle Kontexte, in denen Antisemitismus erfahren wird. In einer Studie mit mehr als 500 jüdischen Befragten aus dem Jahr 2017 berichtete jeweils etwa ein Drittel von Diskriminierung in Bildungseinrichtungen (Kindergarten, Schule, Ausbildungsstätte, Hochschule) und bei der Arbeit.[3] Auch in einer Studie der „Agentur der Europäischen Union für Grundrechte” von 2013 waren Arbeitsplatz und Schule die am häufigsten genannten institutionellen Kontexte für Diskriminierung.[4] Und mehr als die Hälfte der jüdischen Studierenden in einer aktuellen Studie hat Diskriminierung an deutschen Hochschulen aufgrund der jüdischen Religionszugehörigkeit bei anderen beobachtet, ein Drittel hat sie sogar selbst erlebt.[5]
Qualitative Untersuchungen liegen gegenwärtig für die Institution Schule vor. So können Julia Bernstein, Marina Chernivsky, Friederike Lorenz und Johanna Schweitzer zeigen, wie regelhaft Antisemitismus an Schulen nicht erkannt oder bagatellisiert wird, und dass Schulen zumeist nicht über angemessene Verfahrensweisen verfügen, um jüdische Schüler:innen zu adressieren oder Antisemitismus zu bearbeiten.[6] Für sehr viele andere Institutionen fehlen hingegen entsprechende Untersuchungen, darunter Arbeitsagenturen, Krankenhäuser oder Sozialbehörden.
Es lohnt sich also, die bereits bestehende Forschung zu Institutionen und Antisemitismus zu ergänzen, auch wenn die Antisemitismusforschung damit vor anderen Herausforderungen steht als die Rassismusforschung. So verfügt beispielsweise die Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland auch über Migrationserfahrung und erlebt dadurch zum Teil nicht nur antisemitische, sondern auch rassistische Ausschlüsse. Auch wird Jüdischsein im Umgang mit Institutionen möglicherweise (absichtlich oder unabsichtlich) nicht immer sichtbar. Zudem nimmt aktueller Antisemitismus oftmals codierte Formen an, vor allem in seiner israelbezogenen Variante. Diese Art der Umwegkommunikation lässt sich in ihren Wirkungsweisen schwerer entziffern.
Doch zahlreiche Forschungsfragen können aus der Analyse des Rassismus übertragen werden, etwa: Wann, wo und wie wird das Jüdischsein in Institutionen wie Jobcenter, Einwanderungs- oder Sozialbehörden zum Thema? Was passiert, wenn das der Fall ist? Wann/wo wird eine israelische Staatsbürgerschaft – als mögliche Markierung für ein (angenommenes) Jüdischsein – zum Thema? Wo finden sich in Institutionen christlich-deutsche Normen die zu Wir/Sie-Konstruktionen führen?[7] Was für Erfahrungen verbergen sich hinter den Angaben von Juden:Jüdinnen, die beispielsweise auf dem Arbeitsplatz Diskriminierung erleben? Lassen sich antisemitische Wissensbestände in Organisationen rekonstruieren? Und wenn ja, wann und wie werden diese handlungsleitend? Welche Beschwerdemöglichkeiten haben Betroffene? Welcher Begriff von Antisemitismus ist in der entsprechenden Institution handlungsleitend?
Einer Perspektive auf Institutionen kann mit dieser Art von – aus der Rassismusforschung entlehnten – Fragen gelingen, unter Einbezug der Erfahrungen von Betroffenen Antisemitismus als eine institutionalisierte Diskriminierungsform zu analysieren, die Gemeinsamkeiten, Unterschiede zu und Wechselwirkungen mit Rassismus in der Praxis herauszuarbeiten, und Handlungsempfehlungen für antisemitismuskritische Organisationsentwicklung zu geben.
[1] Schäuble, Barbara: Antisemitische Diskriminierung, in: Scherr, Albert / El-Mafaalani, Aladin / Gökcen, Yüksel (Hrsg.), Handbuch Diskriminierung, Wiesbaden 2017, S. 545-564.
[2] Ebenda, S. 561.
[3] Zick, Andreas/Hövermann, Andreas/Jensen, Silke/Bernstein, Julia, Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland. Ein Studienbericht für den Expertenrat Antisemitismus, Bielefeld 2017, S. 17.
[4] FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, Diskriminierung und Hasskriminalität gegenüber Juden in den EU-Mitgliedstaaten: Erfahrungen und Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Antisemitismus, Wien 2013; http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-discrimination-hate-cr..., S. 55f.
[5] Hinz, Thomas/Marczuk, Anna/ Multrus, Frank, Studentisches Meinungsklima zur Gewalteskalation in Israel und Gaza und Antisemitismus an deutschen Hochschulen, Working Paper Nr. 16, Cluster of Excellence “The Politics of Inequality”, Konstanz 2024, S. 16-19.
[6] Bernstein, Julia, Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Befunde – Analysen – Handlungsoptionen. Weinheim 2020; Chernivsky, Marina/Lorenz, Friederike. Antisemitismus im Kontext Schule. Deutungen und Umgangsweisen von Lehrer*innen an Berliner Schulen. Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, Berlin 2020; https://zwst-kompetenzzentrum.de/wp-content/uploads/2020/11/Forschungsbericht_2020.pdf; Chernivsky, Marina/Lorenz, Friederike/Schweitzer, Johanna, Antisemitismus im (Schul-)Alltag – Erfahrungen und Umgangsweisen jüdischer Familien und junger Erwachsener. Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, Berlin 2020; https://zwst-kompetenzzentrum.de/wp-content/uploads/2021/04/Forschungsbericht_Familienstudie_2020.pdf.
[7] Judith Coffey und Vivien Laumann (2021) verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff der „Gojnormativität“, um die strukturellen Aspekte einer post-nationalsozialistischen deutschen Gesellschaft zu beschreiben, in der die dominante Position nicht-jüdisch ist. "Goj“ ist das jiddische Wort für nicht-jüdische Menschen. Vgl. Coffey, Judith/Laumann, Vivien, Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen. Berlin 2021.
Bildnachweis: Verne Ho / unsplash.com