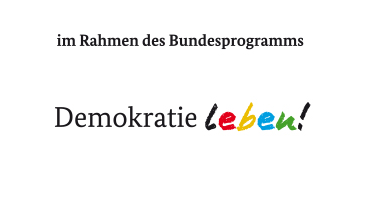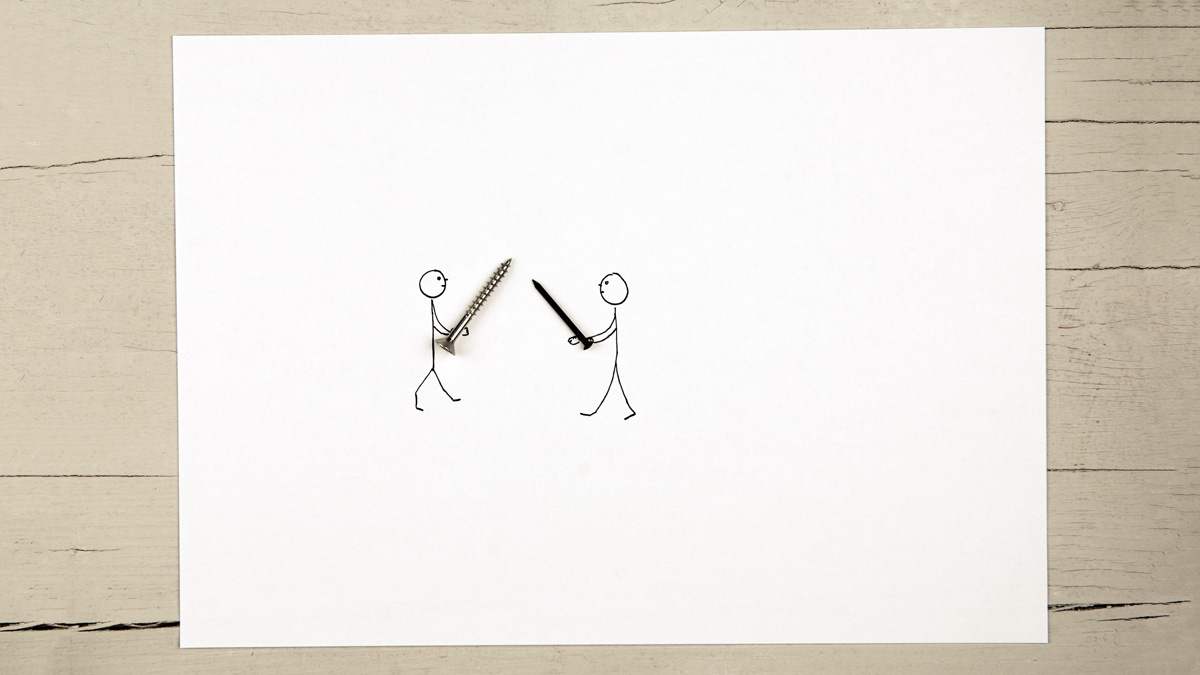
Anerkennung durch Kennenlernen?
Begegnungsansätze
Eine beliebte Form pädagogischer Intervention gegen Antisemitismus ist die Begegnungspädagogik, die auf das Konzept der „interkulturellen Pädagogik“ zurückgeht. Zentrales Ziel des Begegnungsansatzes ist der Abbau von Vorurteilen und Stereotypen durch reale Erfahrung, nämlich „indem ‚der Andere‘ – über den oft phantasiert wird, ohne dass er/sie real bekannt ist – in seiner spezifischen, aber auch allgemein menschlichen Natur erlebt wird.“1
Durch den persönlichen Kontakt und Dialog kann im Idealfall eine an die Person oder Gruppe gebundene Auseinandersetzung erfolgen, in der verallgemeinernde Bilder irritiert oder entkräftet, eigene Vorurteile hinterfragt, korrigiert oder überwunden werden. Ein solcher Lernprozess kann dazu motivieren, unbekannte Perspektiven wahrzunehmen, dem Gegenüber mit Offenheit und auf Augenhöhe zu begegnen und im direkten Kontakt kennenzulernen und zu erleben, anstatt bloß auf einer abstrakten Ebene über „die Anderen“ zu sprechen.
Jüdisch-nichtjüdische Begegnungen gibt es in unterschiedlichen Kontexten und Formaten. Zum Beispiel stellt der interreligiöse Austausch die Religion und das Reden über sie in den Mittelpunkt, während etwa in der historisch-politischen Bildung die Begegnung mit Shoah-Überlebenden lange als ein wichtiges und zentrales Instrument zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus betrachtet wurde. Auch können Begegnungsprojekte mit Jüdinnen und Juden im Kontext einer Auseinandersetzung mit antisemitischen Vorurteilen und Diskriminierungen stehen.
Was jüdisch-nichtjüdische Begegnungen für viele zu etwas Besonderem macht ist, dass ansonsten die „natürliche“ Begegnungslandschaft oft begrenzt oder sogar völlig inexistent ist. Zwar stellt für Jüdinnen und Juden der Kontakt zu Angehörigen der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft keine Besonderheit dar. Doch weil die jüdische Minderheit verhältnismäßig klein ist, sich manche aus Angst vor Anfeindungen nicht öffentlich zu erkennen geben und auch jüdische Institutionen starken Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen unterliegen, ist für viele Menschen die alltägliche Begegnung statistisch eher unwahrscheinlich und bleiben ihnen jüdische Lebenswelten oft weitgehend unbekannt. Entsprechende Begegnungsprojekte bieten also die Möglichkeit, einmal auf Jüdinnen und Juden zu treffen, zu denen man sonst kaum oder gar keinen Kontakt hatte.
Der wohl wichtigste Faktor einer Begegnung ist der Dialog, und zwar unabhängig davon, welcher thematische Rahmen dafür gewählt wird. Hieraus können sich gegebenenfalls nicht nur Anerkennungsmomente ergeben, sondern auch Solidarisierungseffekte, zumindest aber ein ehrlicher Austausch, der womöglich in anderem Rahmen nicht stattgefunden hätte. Dies kann für beide Gruppen bedeutend sein.
Jedoch muss politische Bildung auch stets hinterfragen: Inwiefern schaffen es derartige Begegnungen wirklich, über Reflexionsmöglichkeiten selbstkritische Effekte zu erzeugen und bestehende Vorurteile zu irritieren oder gar zu überwinden? Erweist sich dieser Ansatz als ausreichend, um aktuellen Formen des Antisemitismus zu begegnen oder muss er nicht vielmehr mit anderen pädagogischen Inhalten und Maßnahmen kombiniert werden?
Das Dilemma der Differenzkonstruktion
Begegnungsprojekte bergen einige kalkulierbare und nicht kalkulierbare Risiken, die bei einer Durchführung stets berücksichtigt werden sollten. Denn eine Begegnung oder ein Austausch kann auch Auswirkungen zur Folge haben, die den pädagogischen Zielen und Vorstellung der Pädagogen/innen zuwiderlaufen.
So besteht ein grundsätzliches Dilemma jüdisch-nichtjüdischer Begegnungen darin, dass sie dazu tendieren, innerhalb der Logik der Differenzkonstruktion zu verbleiben. Insofern das Gegenüber hauptsächlich als Angehörige/r einer definierten, mehr oder minder homogenen und mit entsprechenden Zuschreibungen markierten Gruppe wahrgenommen wird, steht in erster Linie die vermeintliche Andersartigkeit im Vordergrund. Eine wissenschaftliche Expertise beschreibt das Problem so: „Interkulturelle Begegnungen, in denen Individuen veranlasst sind, sich als Repräsentanten von Kollektiven zu treffen und sich gegenseitig jeweilige Besonderheiten und Eigentümlichkeiten vorzuführen, sind vielfach wenig hilfreich. Denn sie können gerade zu einer Einübung in gut gemeinte Stereotype führen, die wiederum Anschlussmöglichkeiten für Formen der Feindseligkeit oder für eine Aufladung der Bedeutung religiöser Differenz enthalten.“2
Ein maßgebliches Ziel politischer Bildungsarbeit sollte es jedoch sein, Diversität sichtbar zu machen, wertzuschätzen und aus stereotypisierenden und kulturalisierenden Zuschreibungen auszubrechen. Stattdessen werden Jüdinnen und Juden allzu leichtfertig auf einen singulären Aspekt ihrer Identität reduziert, nämlich auf ihre religiöse Zugehörigkeit. Dabei bleibt oft unberücksichtigt, dass die Selbstbeschreibung „jüdisch sein“ äußerst unterschiedlich und divers ausfallen kann.
Bei der dezidierten Thematisierung von Antisemitismus hingegen besteht nicht nur Gefahr, dass die jüdischen Teilnehmenden antisemitischen Klischeevorstellungen oder fehlender Sensibilität ihrer nichtjüdischen Gesprächspartner/innen ausgesetzt sein könnten. Darüber hinaus kann auch eine eindimensionale Rollenerwartung gegenüber Jüdinnen und Juden als bloße Opfer die ohnehin vorhandene Asymmetrie noch verstärken – und die übrigen Teilnehmenden in die Rolle potentieller Antisemiten/innen drängen. Im pädagogischen Setting können solche statischen Rollenbilder äußerst hemmend wirken und die Dynamiken von Gegenseitigkeit verunmöglichen.
In wohl jeder Begegnung ist das Moment der gegenseitigen Sympathie von großer Bedeutung, doch birgt es zugleich ein nicht kalkulierbares Risiko: Sollten jüdische Teilnehmende als unsympathisch erlebt werden, so könnte dies eventuell vorhandene Abneigungen bestätigen oder sogar noch verstärken. In diesem Fall gäbe es keine Interventionsmöglichkeiten seitens der Pädagogen/innen. Ähnlich verhält es sich mit dem Bestätigen von Klischees: Werden stereotype Vorstellungen scheinbar bedient, kann dies zu ihrer Verfestigung beitragen.
Misslingen können Begegnungsprojekte schließlich auch an fehlender oder nicht fundierter Vor- und Nachbereitung seitens der Pädagogen/innen. Werden Faktoren wie Selbst- und Fremdbilder, Dialogbereitschaft und Gesprächsoffenheit, Interessen und Motivationen sowie Befindlichkeiten und Bedürfnisse der Teilnehmenden nicht diskutiert und berücksichtigt oder nur unzureichend reflektiert, so werden die Projektziele kaum zu erreichen sein.
Bei all diesen Hindernissen und Einwänden wird deutlich, dass im Bildungskontext Begegnungen mit Jüdinnen und Juden allein wohl kaum ausreichen, um antisemitischen Vorurteilsstrukturen wirksam entgegenzutreten. Doch besteht das Dilemma der Begegnungspädagogik zugleich in einer noch tieferliegenden Dimension: „Werden Begegnungen als unvermittelte Antwort auf antisemitische Äußerungen initiiert und wird angenommen, dass der direkte Kontakt mit Juden Antisemitismus ‚beseitige‘, so handelt es sich um ein Vorgehen, das den grundsätzlichen Strukturen des Antisemitismus ‚aufsitzt‘.“3 Die Vorstellung nämlich, antisemitische Ressentiments ließen sich einfach durch reale Erfahrung korrigieren, folgt einer falschen Logik. Denn Antisemitismus hat nichts mit dem tatsächlichen Verhalten jüdischer Menschen zu tun. Vielmehr gibt er Aufschluss über die Träger/innen des Vorurteils und über die Gesellschaften, in denen Judenfeindschaft seit Jahrtausenden besteht. Für die Auseinandersetzung mit antisemitischen Zuschreibungen erscheint es deshalb von Bedeutung, die ideologische Konstruktion bzw. Konstruiertheit der Gruppe ‚die Juden‘ (als ‚die Anderen‘) in den Blick zu nehmen und die dahinterliegenden Funktionen und Motivationslagen zu erforschen.
Was tun?
Den Pädagogen/innen muss klar sein, dass jüdisch-nichtjüdische Begegnung keine Selbstläufer sind, sich nicht in jedem Fall als Interventionsmaßnahme eignen und auch kein Garant für den Abbau von Vorurteilen sind. Dennoch können sie sich – bei sorgfältiger Vor- und Nachbereitung sowie einer gelungenen Prozessbegleitung – durchaus als pädagogischer Ansatz eignen, um stereotypisierenden und kulturalisierenden Zuschreibungen entgegenzuwirken.
Im Vorfeld tun Anleitende und Teilnehmende gut daran, ausführlich zu reflektieren und zu klären, wer denn überhaupt die Gruppen sind, die sich da begegnen sollen. Wie definieren sich die jeweiligen Gruppen selbst, welche verbindenden Merkmale eint sie und wo gibt es Differenz? Welche Sichtweisen haben sie auf die andere Gruppe, und welche Erwartungen oder Befürchtungen sind damit verbunden? Das Vorgehen sollte eine Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten und Konstruktionen des „Wir“ und „die Anderen“ umfassen, aber auch die Frage nach den Deutungshoheiten darüber miteinbeziehen.
Die Pädagogen/innen selbst sollten sich diesen Fragen ebenfalls stellen und sich eventueller eigener Zuschreibungen an die Gruppen bewusst werden. Darüber hinaus ist dringend zu empfehlen, nicht lediglich den thematischen Schwerpunkt und Ablauf der Begegnung festzulegen, sondern sich auch besonnen zu überlegen: Was möchte ich mit dieser Begegnung erreichen? Habe ich Fragen, Ideen und Wünsche der Teilnehmenden in den Ablaufplan integriert? Welche Schwierigkeiten könnten sich ergeben? Wie möchte ich damit umgehen?
Die Gruppen sollten möglichst gleich aufgestellt sein, sich also in Anzahl der Teilnehmenden, Alter, Bildungsgrad etc. ähneln. Sinnvoll sind ein gemeinsames Thema und eine gemeinsame Aufgabenstellung, damit das Verbindende und der Dialog im Vordergrund stehen. Je nach Themenschwerpunkt und Anforderungen muss eine inhaltliche Vorbereitung erfolgen; denn wird bspw. das Thema Judentum behandelt, so sollte sich die nichtjüdische Gruppe dazu bereits erste Grundlagen erarbeitet haben. Im Übrigen ist auch die sorgfältige Nachbereitung ein wichtiger Baustein zum Erfolg solcher Projekte.
Gleichzeitig muss in jeder jüdisch-nichtjüdischen Begegnung mitgedacht werden, was für beide Gruppen zumutbar ist und in welchem gesellschaftlichen Kontext eine Begegnung stattfindet. Vor allem ist zu gewährleisten, dass der gemeinsame Austausch einen geschützten Raum darstellt, der insbesondere die jüdischen Teilnehmenden vor Feindseligkeiten bewahrt.
Festzuhalten bleibt: Motivieren Begegnungen nicht zu einer (selbst-) kritischen Auseinandersetzung mit Differenzierungen, Kategorisierungen und Zuschreibungen, dann sollten sie nicht primär als eine Interventionsform gegen Antisemitismus verstanden werden. Vor diesem Hintergrund scheint es ratsam, Begegnungen mit Jüdinnen und Juden möglichst mit anderen pädagogischen Ansätzen der Antisemitismuskritik zu kombinieren und gegebenenfalls in weitergefasste Bildungsprozesse zu integrieren.
Ruth Fischer ist Mitbegründerin und war bis 2019 Redakteurin von „Anders Denken – Die Onlineplattform für Antisemitismuskritik und Bildungsarbeit“
Malte Holler ist Mitbegründer und war bis 2019 Redakteur von „Anders Denken – Die Onlineplattform für Antisemitismuskritik und Bildungsarbeit“
Anmerkungen
1 Monique Eckmann: Gegenmittel. Bildungsstrategien gegen Antisemitismus. In: Einsicht 08. Bulletin des Fritz Bauer Instituts (2012), S. 44-49, hier S. 48. PDF
2 Albert Scherr/Barbara Schäuble: „Ich habe nichts gegen Juden, aber…“. Ausgangsbedingungen und Perspektiven gesellschaftspolitischer Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. Berlin 2007, S. 59. PDF
3 Heike Radvan: Formen pädagogischer Intervention im Horizont wahrgenommener Antisemitismen. Perspektiven für die Aus- und Weiterbildung von Jugendpädagoginnen. In: Wolfram Stender/Guido Follert/Mihri Özdogan (Hg.): Konstellationen des Antisemitismus. Antisemitismusforschung und sozialpädagogische Praxis. Wiesbaden 2010, S. 165-183, hier S. 180.
Zum Weiterlesen
Marina Chernivsky/Christiane Friedrich/Jana Scheuring (Hg.): Praxiswelten – Zwischenräume der Veränderung – Neue Wege zur Kompetenzerweiterung. Frankfurt am Main 2014. PDF
Marina Chernivsky: Die Bedeutung der Anti-Bias-Pädagogik in der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus, in: Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) (Hg.): PerspektivWechsel. Theorie, Praxis, Reflexionen. Frankfurt am Main 2010, S. 28-35. PDF
Michal Kümper/Susanne Harms: Chancen und Grenzen von jüdisch-nichtjüdischen Begegnungen als pädagogischer Ansatz gegen Antisemitismus. In: Wolfram Stender/Guido Follert/Mihri Özdogan (Hg.): Konstellationen des Antisemitismus. Antisemitismusforschung und sozialpädagogische Praxis. Wiesbaden 2010, S. 265-286.
Multikulturelles Forum e. V. (Hg.): „Hallo! Schalom! Selam! Privjet! Gemeinsam gegen Vorurteile“. Ergebnisse und Handlungsempfehlungen. Lünen 2014. PDF
Barbara Schäuble: „Anders als wir“. Differenzkonstruktionen und Alltagsantisemitismus unter Jugendlichen. Anregungen für die politische Bildung. Berlin 2012.
Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK)/amira – Antisemitismus im Kontext von Migration und Rassismus: „Unsere Jugendlichen müssten mal Juden kennen lernen!“ Begegnungen mit Jüdinnen und Juden als pädagogischer Ansatz zum Abbau von Antisemitismus. Berlin 2010. PDF
Bildnachweis: David-W- / photocase.de