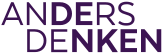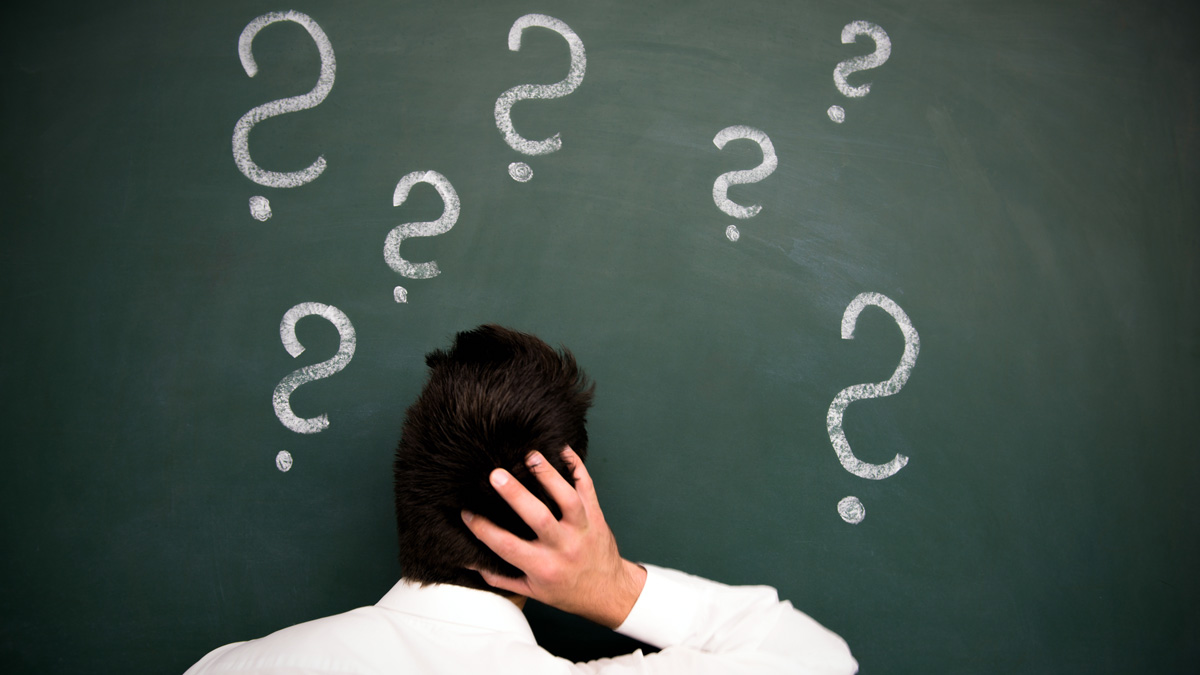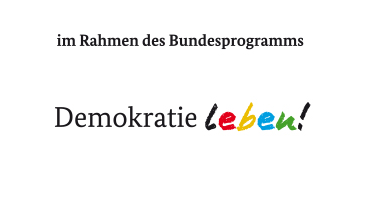Der 7. Oktober 2023. Die Vergewaltigungen in Israel und in den Tunneln in Gaza: Das Schweigen der nichtjüdischen Feministinnen und Frauenorganisationen bundes- und weltweit
Ein Beitrag von Sharon Adler (Publizistin, Fotografin, engagiert sich gegen Antisemitismus und für Feminismus)
[Inhaltswarnung: Der Artikel enthält Beschreibungen von sexuellem Missbrauch, Folter und Mord]
Berlin, September 2024. Bis zum 7. Oktober sind es gefühlt nur noch wenige Tage. Der erste Jahrestag des Massakers gegen die Menschen in Israel rückt unweigerlich näher und mit ihm die Sorge, was er auslösen wird. Der Gedanke daran, was in Israel und der jüdischen Welt in der Diaspora geschehen könnte, ob, wann und wo die von der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah und von ihren Anhänger:innen öffentlich angekündigten Attentate und eine „Fortsetzung“ des 7. Oktober in die Tat umgesetzt wird, ist omnipräsent.
Die in den Tagen nach dem 7. Oktober 2023 von den islamistischen Terroristen zum „Freiwild“ deklarierten Jüdinnen und Juden erleben weltweit seitdem eine so nach 1945 noch nicht erlebte Welle des Hasses. Der Aufruf zum Mord findet sich auf den Hauswänden von Paris über Amsterdam bis Bremen (Nur ein paar Beispiele: „Killing Jews is not a crime“, „Kill Jews“, „Viva Hamas“, „Für jeden Zionisten 1 Kugel“). Jüdinnen und Juden sollen sich nicht mehr sicher fühlen. Nirgends.
In welchem Ausmaß die jüdische Community seit dem 7. Oktober das Ziel antisemitischer Attacken wurde, zeigt der aktuelle Monitoringbericht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) und die Statistik der Anti-Defamation League (ADL).
Im Juni 2024 wurde eine Zwölfjährige in der Nähe von Paris das Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Weil sie Jüdin ist.
Sexualisierte Gewalt am 7. Oktober 2023
Das Pogrom am 7. Oktober in den Kibbuzim und auf dem Nova Musikfestival richtete sich gezielt gegen Frauen und Mädchen.
Wir erfahren von weiblichen Opfern, die von zehn oder mehr Tätern mit brutaler Gewalt vergewaltigt wurden, von Schwangeren, deren Fötus erschossen wurde. Von Babys, denen entsetzliches Leid angetan wurde, während ihre gefesselten Mütter gezwungen wurden, dabei zuzusehen. Von Frauen, die vor den Augen der Familie und Partner:innen brutal vergewaltigt wurden.
Das Schweigen nichtjüdischer Feministinnen. Reaktionen auf die Dokumentation sexualisierter Gewalt am 7. Oktober.
Wer, so wie ich und andere Jüdinnen auch (und im Übrigen unsere feministischen Verbündeten ebenso), geglaubt hat, dass sich angesichts der unvorstellbar grausamen Verbrechen, der Deutlichkeit der Bilder und Informationen Feministinnen und Frauenrechtsorganisationen an unsere Seite stellen würden, dass sie Empathie und Solidarität zeigen und auf die Straße gehen, um gegen diese Gewalt gegen Frauen lautstark zu protestieren, dass sie Petitionen oder Mahnwachen initiieren, wurde bitter enttäuscht. Trotz der öffentlich zugänglichen Dokumentationen, der Testimonials der Überlebenden, der Zeuginnen und Zeugen passierte all das nicht. Im Gegenteil. Es formierte sich innerhalb weniger Tage eine laute und sichtbare antisemitische Allianz, die die Verbrechen legitimierte. Und mehr.
Seit dem 7. Oktober habe ich auf ein Zeichen von Frauenorganisationen, von Feministinnen gewartet, die sexualisierte Gewalt gegen die Frauen in Israel zu thematisieren, sie anerkennen und verurteilen.
Als Herausgeberin der feministischen Online-Zeitschrift AVIVA-Berlin habe ich am 25. November 2023, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, jede einzelne eingehende Pressemitteilung von Frauenrechtsorganisationen nach einem Wort, einem Zeichen der Solidarität oder auch nur der Anteilnahme abgesucht. Vergeblich. Es gab keins.
Nur ein paar Beispiele: Die größte Frauenrechtsorganisation weltweit, UN Women, veröffentlichte am 20. Oktober 2023 einen Bericht mit dem Titel „UN Women Rapid Assessment and Humanitarian Response in the Occupied Palestinian Territory„ begleitet von einer offiziellen Erklärung. Eine Verurteilung oder Ankündigung von Untersuchungen der sexualisierten Gewaltverbrechen vom 7. Oktober, oder einen Appell zur Freilassung der aus Israel verschleppten Frauen, darunter junge Mädchen und ältere Frauen, stellte die Organisation nicht. Auch eine Aufforderung an das Internationale Rote Kreuz (IRK), die verletzten Geiseln zu behandeln oder denen, die aufgrund chronischer Vorerkrankungen medizinische Versorgung benötigten diese zukommen zu lassen, blieb aus. Bis heute hat das IRK keine Anstrengungen in diese Richtung unternommen.
Die Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, brauchte zwei Monate, um die Beweise von sexueller Gewalt anzuerkennen. Beweise, die ihr schon sehr viel länger vorlagen. Erst auf Druck von jüdischen und israelischen Menschrechtsabgeordneten erklärte sie am 4. März 2024 (!) erstmals in einem öffentlichen Statement: „klare und überzeugende Informationen, dass die Geiseln in Gaza sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind“. (Original: „Clear and convincing information that hostages in Gaza subjected to sexual violence“).
Passt das Leid der Israelinnen nicht in die Narrative feministischer Organisationen? Sind jüdische Opfer sexualisierter Gewalt weniger wert oder fallen sie nicht unter das internationale Recht? Das Schweigen und Verschweigen bedeuteten für mich eine absolute Bankrotterklärung des Feminismus.
Werden die Hamas-Terroristen, deren Unterstützer:innen, die Zivilist:innen aus Gaza, Mitarbeiter:innen der UNWRA und des Internationalen Roten Kreuzes jemals vor dem Obersten Gerichtshof für die Ausführung der Verbrechen oder die unterlassene Hilfeleistung bestraft? Warum sehe ich keine Kundgebungen, die genau das fordern? Wo findet eine öffentliche Verurteilung oder Kritik statt? Wo sind unsere Allies? Und warum, frage ich, schweigt unsere „feministische Außenministerin“ und der Instagram-Kanal des Auswärtigen Amtes so beharrlich oder übt sich allenfalls in Plattitüden, die durchweg mit einem „aber“ enden?
Seit fast einem Jahr sind Frauen und Mädchen in der Gewalt von Vergewaltigern, sind permanenter sexueller Gewalt ausgesetzt. Die in feministischen Kreisen gefeierte US-amerikanische Philosophin Judith Butler findet die Gelegenheit günstig, sich zu solidarisieren. Mit den Tätern.
Die Dokumentation sexualisierter Gewalt am 7. Oktober
Tag für Tag erfahren wir in den Testimonials der Überlebenden und der in einem Deal freigelassenen oder von der israelischen Armee befreiten Geiseln mehr und mehr grausame Details. Wir wissen auch von diesen Taten, weil die Täter sie selbst gefilmt haben. Mit den Handys der Opfer. Die Fotos und Videos wurden an Familienangehörige verschickt oder über ihre Sozialen Netzwerke online gestellt. Wir alle kennen die Bilder auch, weil sie von den Helfershelfern der Terroristen, an Associated Press verkauft wurden.
Um die Kriegsverbrechen der Hamas zu dokumentieren, haben israelische und internationale Organisationen unmittelbar nach den Massakern damit begonnen, Beweismaterial zu sammeln. Dokumentiert wurden die sexualisierten Gewaltverbrechen unter anderem von den Ersthelfer:innen der israelischen Freiwilligenorganisation Zaka, außerdem im Bericht „Sexual Crimes in the October 7 War. Silent Cry“ des Special Report of the Association of Rape Crisis Centers in Israel sowie im „The October 7th Geo-visualization Project. Mapping the Women´s Massacre“ und auf den Seiten der weniger als 24 Stunden nach dem Massaker ins Leben gerufenen Organisation „The Hostages and Missing Families Forum“. In dem Dokumentarfilm „Screams Before Silence“ unter der Regie von Anat Stalinsky und initiiert von Sheryl Sandberg, ehemalige Direktorin von Meta und Gründerin von LeanIn.org berichten Überlebende und Zeug:innen vor einer Kamera und zum ersten Mal über die Grausamkeiten, die ihnen angetan wurden. Das filmische Zeugnis wurde inzwischen vor Journalist:innen weltweit gezeigt und kann für Vorführungen ausgeliehen werden.
Um auf die Verbrechen aufmerksam zu machen, sprach die renommierte israelische Expertin für internationales Recht, Menschen- und Frauenrechte, Dr. Cochav Elkajam-Levy Ende Oktober 2023 vor Vertreter:innen der UN und im Weißen Haus. Sie hat die „Zivile Kommission für Hamas-Verbrechen am 7. Oktober gegen Frauen und Kinder in Israel“ mit der Mission gegründet: „Wir sammeln alle verfügbaren Informationen über die Gewalt, die Frauen und Kindern am 7. Oktober und seither in der Gefangenschaft der Hamas in Gaza zugefügt wurde. Unser vorrangiges Ziel ist es, diese Berichte für die historische Dokumentation zu bewahren, sie im Kontext des internationalen Rechts zu analysieren und Gerechtigkeit für die Opfer zu suchen.“
Die israelische Menschenrechtsaktivistin Danielle Ofek hat auf die einseitige Positionierung von „UN Women“ reagiert, und die Kampagne #MeToo_UNless_UR_a_Jew initiiert: „Wenn es darum geht, ein 'globaler Vorkämpfer für die Gleichstellung der Geschlechter' zu sein und das Bewusstsein für Menschenrechtsverletzungen an Frauen zu schärfen, ist es ganz klar, dass für UN Women und die UN insgesamt Juden einfach nicht zählen.“ Folglich lautet ihre Frage auf deren anhaltendes Schweigen: „Wo sind eure Augen, UN Women“ (Original: "Where are your eyes, UN Women?")
Beleidigt, bespuckt, bedroht. Erfahrungen einer Gruppe jüdischer Queers im Vorfeld des Dyke* March Berlin
Wie positioniert sich die queerfeministische Szene, die LGBTIQ-Community in Deutschland? Dazu nur ein Beispiel von vielen: in einer Kreuzberger Bar kam es Anfang Juli 2024 im Vorfeld des Dyke* March zu einer offen antisemitischen Aggression gegen eine Gruppe fünf jüdischer Queers und Allies. Sie hatten auf einen Post auf dem Instagram Account des Dyke* March-Orga-Teams aufmerksam gemacht, der auf dem offiziellen Flyer rote Hamas-Dreiecke abgebildet und Israel verunglimpfende Stereotypen bedient hatte. Die Gruppe entschied sich dazu, in einen Austausch zu gehen. Zu einem respektvollen Gespräch kam es nicht. Im Gegenteil. Die Gruppe wurde als „Zionistenschweine“, „Zionist Rapists“, „Faschisten“ und als „Genocide Supporters“ beschimpft, bedroht und massiv bedrängt. Die „Provokation“ hatte darin bestanden, eine Regenbogenfahne mit Davidstern aufzuhängen, ein Plakat mit der Aufschrift „safe Table for Jews and Israelis“ und Sticker mit dem Slogan „I Believe Israeli Women“ auszulegen. Nachdem ich auf AVIVA-Berlin den Beitrag „Auch vor dem Dyke* March macht der Antisemitismus keinen Halt“ einer der anwesenden jüdischen Queers mit ihrer Dokumentation der Abläufe des Abends veröffentlicht habe, wurde ich von einer der Dyke* March-Organisator:innen telefonisch belehrt. „Antizionismus ist kein Antisemitismus“ erklärte sie mir. Das kenne ich anders.
Das alte Lied und neue Realitäten
Antisemitismus in der Frauen- und Lesbenszene hat eine lange Tradition in Deutschland. Erschreckend ist, wie wenig dazu eine Aufarbeitung stattgefunden hat.
Als Jurorin des „Berliner Preises für lesbische Sichtbarkeit“ musste ich erleben, wie ein Großteil des Publikums auf meine Laudatio für den lesbisch-feministischen Schabbeskreis reagierte. Ich hatte darin auch den Antisemitismus angesprochen, mit dem die Jüdinnen in den 1980er Jahren konfrontiert waren. Hatte den Bezug zu den Ausgrenzungen der queeren jüdischen Community nach dem 7. Oktober hergestellt.
Dass das auf wenig Zustimmung stoßen würde, war mir zwar schon vor dem Gang zum Stehpult im Roten Rathaus klar, dennoch kann die Realität bekanntlich ernüchternd sein.
Falls jetzt die Frage danach aufkommt, warum die antijüdische Propaganda und die propalästinensische Manipulation in der nichtjüdisch-queerfeministischen Szene so gut ankommt und reibungslos funktioniert, nur so viel: es ist ein mindestens abendfüllendes Thema. Die Dokumentation antijüdischer Narrative und Verschwörungsmythen der letzten Jahre würde den Rahmen dieses Beitrags schlicht sprengen.
Festzuhalten gilt jedoch, dass insgesamt ein fehlendes Wissen um die gemeinsame deutsch-jüdische Geschichte mit Blick auf die Beteiligung von Jüdinnen in demokratischen, frauenpolitischen Prozessen wie etwa in der Frauen- und Arbeiter:innenbewegung und dem Kampf um das Frauenwahlrecht vorherrscht. Dass die Gründung der Sozialarbeit maßgeblich auf Jüdinnen wie Alice Salomon und Bertha Pappenheim zurückgeht, wissen heute die wenigsten.
Festzuhalten gilt auch das fehlende Wissen um die Entstehung des Staates Israel, seine Kultur(en) und die Menschen aus 70 Ländern, die heute dort leben. Israel, die einzige Bastion in dieser Region, in der Angehörige der queeren Community sich offen und gefahrlos lieben, heiraten, Kinder adoptieren können, wo sie nicht, wie in Gaza oder anderen radikal islamischen Gesellschaften von Dächern in den Tod geworfen werden. Ausgerechnet dieser multikulturellen, multiethnischen Gesellschaft Israel wird von weißen deutschen Palituchträger:innen „Pinkwashing“ vorgeworfen, während sie gleichzeitig einem patriarchal-islamistischen Narrativ huldigen.
Bildung neuer feministischer Allianzen. Strategien gegen das Verleugnen, Schweigen und Verschweigen.
Welche Auswirkungen die Entsolidarisierung und das hemmungslose Zelebrieren des selektiven Feminismus auf die Frauen*projektelandschaft, aber auch auf die Kulturlandschaft von heute hat, muss offen diskutiert werden. Fest steht: Wir stehen vor einem Scherbenhaufen und noch am Anfang eines neuen Zeitalters, in dem das Schweigen vermeintlicher Verbündeter seit dem 7. Oktober in der jüdischen Community niemals vergessen werden kann. Es gibt keine Möglichkeit, das Zerstörte zu kitten.
Aber, und das macht Hoffnung: es gibt, wenn auch vereinzelt, starke Stimmen der Solidarität und Menschen, die mit öffentlichen Aktionen wie der East-Pride-Demo oder auf den Mahnwachen gegen Antisemitismus für die Sichtbarmachung und gegen eine Täter-Opfer-Umkehr an der Seite von Jüdinnen und Juden stehen. Auch wenn sie sich damit angreifbar machen. Eine nicht repräsentative Auswahl: Das (queer)feministische Bündnis zum 8. März „Feminism Unlimited“, die Organisationen und Initiativen wie „Frauen für Freiheit“, „Lesben gegen Rechts“, „Homos sagen Ja zu Israel – Queers for Israel“, „Feminists against Antisemitism“, „Fusionistas against Antisemitism and Antizionism“ und „Queers Against Antisemitism“.
Eine besonders möchte ich an dieser Stelle nennen, Karoline Preisler. Die Juristin, eine Nichtjüdin, stellt sich – meist allein – bei israelfeindlichen, antisemitischen Aufmärschen der wütenden Menge mit ihren Demoschildern „Believe Israeli Women“ und „Rape is not resistance“ entgegen.
Die Folgen für die Menschen in Israel und für die jüdische Community weltweit.
Ich habe Angst vor dem 7. Oktober 2024 und vor allen zukünftigen Jahren mit diesem Datum. Ich habe Angst, dass Islamisten den 7. Oktober feiern, die Toten und Verschleppten verhöhnen und ihn dafür nutzen könnten, zu noch mehr Gewalt gegen Jüdinnen und Juden aufzurufen. Ich habe Angst vor der Kälte der deutschen Nachrichtensprecher:innen, vor einer knappen Meldung zwischen Sport und Wetter, Angst, dass Annalena Baerbock etwas Gefühlloses sagt oder auch nichts sagt. Beides wäre gleich schlimm.
Seit dem 7. Oktober 2023 ist beinahe ein Jahr vergangen und dennoch scheint es mir so, als sei seitdem die Zeit stehengeblieben. Als sei ich in einer Schleife gefangen, die sich um die immer gleichen Bilder dreht. Es ist das Bild von Shani Louk, die regungslos auf der Ladefläche eines Pick-ups liegt, umringt von johlenden Hamas-Terroristen, die sich und ihre „Beute“ stolz den Kameras präsentieren – in Siegerpose, die Waffen hoch erhoben, der Stiefel fest auf dem halbnackten Frauenkörper. Oder das Video von Naama Levy. Es zeigt, wie sie von einem Hamas-Terroristen aus einem Jeep gezerrt wird: mit auf dem Rücken gefesselten Händen, die Jogginghose am Gesäß blutverschmiert. Verängstigt. Vergewaltigt. Verschleppt. Vor aller Augen.
Ihre Namen und diese Bilder sind es, die mich unaufhörlich begleiten. Doch es sind nicht nur die Bilder allein, es ist eben auch die Reaktion darauf. Die ausbleibende Reaktion. Noch immer fassungslos bin ich darüber, wie angesichts dieser Bilder, Dokumentationen und Testimonials die feministische und LGBTIQ-Community bis heute die sexualisierte Gewalt eiskalt verleugnen und sogar verteidigen kann.
“Believe the victims” ist das Credo des Feminismus. Vergewaltigung ist Vergewaltigung. Gewalt gegen Frauen ist ein Verbrechen. Das Anzuzweifeln ist für mich der Verrat der feministischen Bewegung.
Rückzug oder Resilienz?
Das Wissen um die Vergewaltigungen und der explodierende Antisemitismus macht mein persönliches Leben und professionelles Arbeiten seit dem 7. Oktober zu einer ständigen Herausforderung. Seit dem 7. Oktober 2023 ist nichts mehr wie zuvor.
Der 7. Oktober hat neue, unvorstellbare Dimensionen des Hasses auf Jüdinnen und Juden offenbart. Ausgelöst hat er ihn nicht.
Bildnachweis: Fujiphilm / unsplash.com