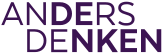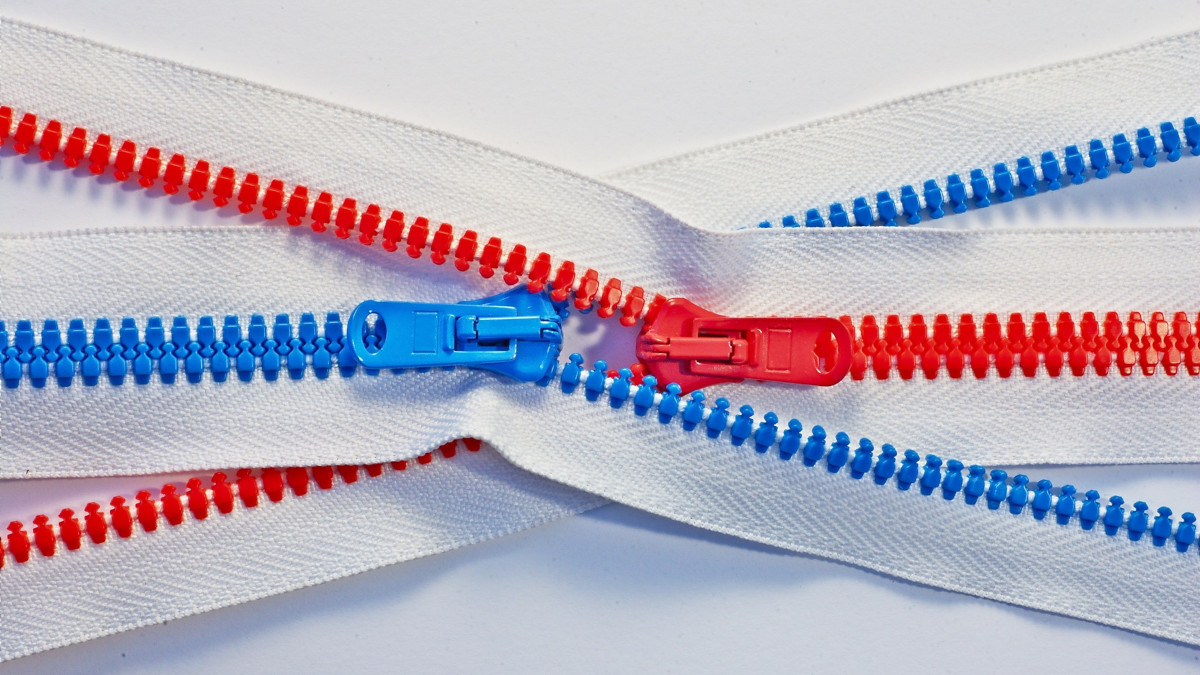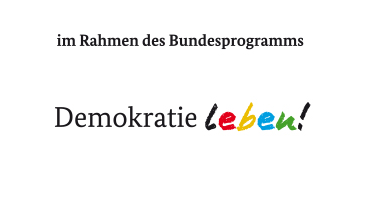Komplexität aushalten
Widerspruchstoleranz
Widerspruchstoleranz bezeichnet die Fähigkeit, Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeiten wahrzunehmen und zu ertragen. Die Stärkung dieser Kompetenz kann ein Ansatz bei der Bekämpfung von Antisemitismus sowie anderer Phänomene Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) sein.
Die spezifische Dimension des Antisemitismus, die ihn von anderen Formen von Vorurteilen und Ressentiments unterscheidet, liegt in seiner spezifischen Funktion als „falsche“ Welterklärung. Indem der Antisemitismus ‚den Juden‘ als Kollektiv konstruiert und diese Gruppe nicht lediglich abwertet, sondern zeitgleich mit nahezu unbegrenzter und omnipotenter Macht ausstattet, kann der Antisemitismus für seine Träger zur falschen Erklärung aller ungerechten Phänomene der Welt herangezogen werden. Antisemitismus schafft für seine Anhänger/innen Selbstbilder durch Fremdbilder, er schafft Orientierung und Sicherheit in einer unsicheren Welt. Gerade diese spezifische Dimension des Antisemitismus ist für die politische Bildungsarbeit zum Thema eine besondere Herausforderung.
Da Antisemitismus nichts über reale jüdische Menschen oder ihr Verhalten aussagt, sondern vielmehr über die Träger des Ressentiments selbst und ihre verdrängten Wünsche Auskunft gibt, bleibt es fraglich, inwieweit durch die Vermittlung bloßer Fakten oder durch aufklärerische Bildungsarbeit dem Ressentiment entgegengewirkt werden kann. Einen vielversprechenderen Weg bietet hier das Konzept der Widerspruchstoleranz.
Das Konzept der Widerspruchstoleranz (bzw. der Ambiguitätstoleranz) geht auf die Arbeiten von Else Frenkel-Brunswick zurück. Die jüdische Psychologin forschte in den 1940er Jahren im US-amerikanischen Exil zusammen mit Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Kollegen/innen im Rahmen der Studien zum autoritären Charakter zur Verbreitung und Genese von Vorurteilen. Frenkel-Brunswick arbeitete dabei vor allem zu Vorurteilen und Ethnozentrismus bei Kindern und untersuchte hier das Phänomen der Ambiguitäts(in)toleranz.1
Ambiguitätstoleranz beschreibt nach Frenkel-Brunswick das Vermögen, Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeit wahrzunehmen und zu ertragen, mit Ungewissheiten und unterschiedlichen Rollenerwartungen sich selbst und anderen gegenüber umzugehen. Es ist eine zweistufige Kompetenz, die sich in die „Wahrnehmung von“ und den „Umgang mit“ (bzw. das Aushalten von) gliedert.
Warum diese Fähigkeit grade für einen kritischen Umgang mit Antisemitismus (und anderen Formen von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit) gestärkt werden muss, offenbart sich bei der Betrachtung seines Gegenteils, der Ambiguitätsintoleranz: Diese bedeutet die Bevorzugung einfacher Zuschreibungen, den schnellen Rückgriff auf einfache Schwarz-Weiß bzw. Gut-Böse-Schemata. Es ist das Bedürfnis, in manichäischen Deutungsmuster zu denken und die Welt nicht in ihrer Komplexität wahrzunehmen, sondern sie beständig zu stereotypisieren und diese Stereotype beständig zu reproduzieren. Frenkel-Brunswick fand heraus, dass bei Menschen, bei denen sie diese Ambiguitätsintoleranz diagnostizierte, Ungewissheit und Komplexität als bedrohlich wahrgenommen werden. Dieser Bedrohung wird mit Angst, Verleugnung oder Aggressivität begegnet, mit dem Ziel individuelle Wahrnehmungen oder Wahrheiten nicht in Frage stellen zu müssen.
Bezogen auf den Antisemitismus und seine spezifische Vorurteilsstruktur bedeutet dies, dass die Komplexität der Welt mitsamt ihren Ungerechtigkeiten, nicht als solche wahrgenommen, sondern auf das Kollektiv ‚der Juden‘ projiziert werden, um sie an ihnen bekämpfen zu können.
Die Stärkung der Widerspruchs- bzw. Ambiguitätstoleranz durch pädagogische Arbeit und politische Bildung, kann somit also einen Beitrag zur kritischen Selbstreflektion und damit auch zum Abbau von Vorurteilen leisten. Diese Kompetenz ist jedoch nichts, was einfach nur an die Teilnehmenden vermittelt werden kann. Auch die in der Bildungsarbeit tätigen müssen sie sich beständig antrainieren und sich selbst sowie ihre Positionen und Handlungen kritisch reflektieren.
Jan Harig ist Mitbegründer und war bis 2019 Redakteur von „Anders Denken – Die Onlineplattform für Antisemitismuskritik und Bildungsarbeit“
Anmerkungen
1 Vgl. Else Frenkel-Brunswik: Studien zur autoritären Persönlichkeit. Ausgewählte Schriften. Wien 1996.
Zum Weiterlesen
Theodor W. Adorno: Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt am Main 1995.
KIgA e.V. (Hg.): Widerspruchstoleranz. Ein Theorie-Praxis-Handbuch zu Antisemitismuskritik und Bildungsarbeit. Berlin 2013. PDF
KIgA e.V. (Hg.): Widerspruchstoleranz 2. Ein Methodenhandbuch zu antisemitismuskritischer Bildungsarbeit. Berlin 2017. PDF
KIgA e.V. (Hg.): Widerspruchstoleranz 3. Ein Methodenhandbuch zu antisemitismuskritischer Bildungsarbeit. Berlin 2019. PDF
Jack Reis: Ambiguitätstoleranz. Beiträge zur Entwicklung eines Persönlichkeitskonstruktes. Heidelberg 1997.
Bildnachweis: Seleneos / photocase.de